Bei den Erdmännchen in Botswana
- 31. Mai 2020
- 9 Min. Lesezeit
Moments of a lifetime...

Jedes Land hat seinen eigenen Geruch und der Duft von Botswana ist besonders intensiv. Ich sitze im offenen Jeep und schließe für einen Moment die Augen. Die Nachmittagssonne ist noch ziemlich kräftig, aber der Fahrtwind kühlt besser, als jede Klimaanlage und ich rieche es wieder: den süßlich, würzigen Duft des wilden Basilikums, getrocknete Gräser, Mist, Erde und ein Hauch Zitrone. Welcome back to Africa!
„Wie lange dauert die Fahrt bis zu unserer Lodge?“, frage ich den Guide. „Hmmm, anything between 20 minutes and two hours, it depends on what we see“, antwortet er. Also Augen auf, Kamera im Anschlag, die Safari kann beginnen.
Und wie sie beginnt: Keine fünf Minuten vom stoppeligen Flugfeld entfernt, steht ein Elefantenbulle am Wegesrand. Der Guide verlangsamt die Fahrt, es sind gefühlt 50 Meter zwischen dem Tier und uns, dann hält er abrupt an. Eine ganze Herde drängt sich aus dem Dickicht, mittendrin Elefantenbabys, die noch so jung sind, dass sie etwas wackelig auf ihren vier Plateaufüßen stehen und arge Schwierigkeiten haben, den Straßengraben zu überwinden. Geduldige Rüssel der Mama und Tante helfen über den Weg, die eine stützt von rechts, die andere drückt von hinten – geschafft. Ich bin so fasziniert, dass ich fast vergesse Fotos zu machen.
Der Bulle hingegen hat uns genau im Visier, der Rüssel geht hin und her, dann fangen die Ohren an zu schlagen, der Guide schaltet den Rückwärtsgang ein und bringt langsam ein paar Meter mehr zwischen uns und den Dickhäuter-Clan. Das entspannt den Chef, er trompetet einmal laut, trottet schnaubend über die Straße und verschwindet im Gesträuch.
Wow, welch ein Szenario. Mein Guide erklärt mir, dass es hier um die Komfortzone der Elefanten geht. Der offene Jeep ist für die Tiere eigentlich nur ein großer, grauer Kasten, den sie gewöhnt sind und der nur wenig interessiert – es sei denn er kommt zu nahe.
„Und woher weiß man, was in den Augen eines Elefanten ‚zu nah’ ist?“ Er lacht. „Ein guter Guide kann die Körpersprache der Tiere deuten“, erklärt er. „Er kennt den Unterschied zwischen einem Teenager Bullen, der einfach nur Theater macht, aber dann doch wegläuft, sobald der Jeep näherkommt, und einem gestandenen Familienoberhaupt, der es ernst meint und darauf besteht, dass das Auto ausweicht.“
Na, dann bin ich ja beruhigt, ich habe einen erfahrenen Guide, der seit Jahren seinen Job macht. Nicht, dass ich ein Neuling in Sachen afrikanischer Wildnis wäre – das muss meine 20ste Safari sein –, aber ich kann ‚Großstadt‘ und keine wilden Tiere… Die nächsten zwei Tage ist also er der Chef.
Am Rande des Okavango-Deltas...
Nach knapp zwei Stunden erreichen wir die Lodge Sable Alley. Sie liegt im privaten Khwai River Gebiet am östlichen Rand des Okavango Deltas. Diese 1.600 Quadratkilometer große Konzession gilt als besonders tierreich und hat nur wenige Camps. Daher ist der Busch hier nahezu unberührt und man trifft selten auf andere Jeeps.
Sable Alley ist eine neue Lodge von Colin Bell. Der Mann ist eine Legende. In den Achtzigern war er einer der Gründer von Wilderness Safaris, die heute zu den erfolgreichsten Anbietern in ganz Afrika gehören. Danach folgte das ambitionierte Projekt Great Plains mit Luxusunterkünften, deren Einnahmen hauptsächlich den Schutz der Tierwelt finanzieren. Eigentlich hätte er sich längst zur Ruhe setzen können, aber: Colin ist ein Energiebündel. Wir kennen uns seit Jahren, ich habe viel von ihm über Afrika, nachhaltigen Tourismus und natürlich den Schutz der Wildtiere gelernt.
Am Abend vor meiner Abreise nach Botswana, haben wir uns noch in Kapstadt getroffen. Es war wie immer herrlich chaotisch: Colin kommt rein und der Raum ist voll. Er redet mit Händen und Füßen, fasziniert mit Geschichten aus dem Busch und seine Energie reißt jeden mit. Derzeit brennt er für sein neuestes Projekt Natural Selection. Das ist ein Label, das für eigentümergeführte Lodges mit besonderen Erlebnissen steht. Alle haben einen großen gemeinsamen Nenner, sie unterstützen die Dörfer vor Ort, sind umweltbewusst und die Wildtiere werden nicht nur geschützt, sondern Ziel ist, den Bestand der bedrohten Tierarten nachhaltig zu erhöhen. Chapeau! Solche Visionäre bräuchten wir mehr!
Jetzt sitze ich hier auf der Terrasse von Sable Alley: Geschmackvoll modernes Design und viele gemütliche Sofas mit Ausblick zum großen Wasserloch, um das sich die zwölf Unterkünfte gruppieren.

Mein Begrüßungskomitee ist tierisch gut drauf – eine Gruppe von Nilpferden glotzt mich neugierig aus dem See an und reißt das Maul auf. Damit ist die Sache klar: keine Alleingänge nach Sonnenuntergang, denn da kommen die Wiederkäuer an Land, um zu grasen. Die Flusspferde wirken harmlos und behäbig, wenn sie mit ihren 1,5 Tonnen schweren Körpern im Wasser liegen. Angeblich sind sie auf ihren kurzen Beinen sehr schnell. An Land können sie bis zu 50 Stundenkilometer erreichen und weil sie sich dort außerhalb ihrer Sicherheitszone bewegen, sind sie leicht erregbar.
Irgendwie beruhigend, dass mein geräumiges Zelt auf einem Plateau liegt und der Guide mich dort abends zum Dinner abholt…
22.00 Uhr. Ich liege endlich im Bett. Die heiße Wärmflasche an den Füßen, lausche ich dem Buschorchester, das an meinem Zelt eine Außenstelle hat. Die Hippos fressen sich gerade genüsslich rund um meine Terrasse den Bauch voll. Hört sich lustig an, erst das Ratschen der Grasbüschel, dann ein Kauen und ab und zu ein Schmatzen.
06.00 Uhr morgens, draußen ist alles noch dunkel und dämmerig und ich höre eine Stimme die sagt: „Knock, knock.“ Wirklich? Ja, da ist es wieder – „Knock, knock. Mrs. Stephanie, this is your wake up call, with coffee and milk.“ Aaaaah, ich bin ja im Busch, das Zelt hat keinen Türrahmen, an dem man klopfen könnte und keine Klingel. Also sagt der Zimmerservice „Klopf-Klopf“. So geht das jetzt die ganze Woche, schon cool.
Eine halbe Stunde später sitze ich mit Schal, Handschuhen und Mütze wieder im Jeep. Im afrikanischen Winter gehen die Temperaturen nachts runter auf bis zu 5 Grad, tagsüber dann wieder rauf bis 28 Grad. Man trägt Zwiebelsystem: also T-Shirt, Fleecepulli und warme Jacke.
In den nächsten zwei Tagen ruckeln wir bei Sonnenaufgang und am späten Nachmittag durch das Wildgebiet über sandige Feldwege und manchmal auch quer durchs Gestrüpp, dabei halten wir Ausschau nach den Tieren.
Die Gegend ist berühmt für ihre große Population der seltenen Wildhunde und eben die hat mir mein Guide quasi versprochen. Zwei Stunden sind wir schon unterwegs, die Kamera ist heiß gelaufen, die Speicherkarte fast voll mit schillernden Vögeln, Zebras, Elefanten und jetzt: Wildhunde! 18 kleine Welpen auf einem Knäuel, die Eltern auf der Jagd. Die kleinen Kerle rollen und tollen übereinander oder kuscheln sich gähnend aneinander, einer findet den Jeep hochinteressant und posiert quasi vor dem Kühler. Ich weiß gar nicht was zuerst – Video oder Foto. Irgendwann bin ich es leid. Wenn man filmt oder fotografiert, verpasst man manchmal den entscheidenden Moment. Ich lege alles beiseite und schaue den tollpatschigen Kerlchen einfach zu.

Nachts wartet ein neues Abenteuer auf mich: das Skybed. An einem Wasserloch sind vier kleine Holztürme auf schmale Stelzen gebaut. Im ersten Stock gibt es ein Bad mit Dusche, auf dem Dach, umgeben von einer niedrigen Balustrade, steht ein gemütliches Bett mit Kuscheldecken, Kissen und einer freien Aussicht: 360° über die Wildnis.
Wir sind passend zum Sundowner hier angekommen, den trinken wir auf dem ‚Barturm’ mit Blick auf Elefanten bei untergehender Sonne. Ist wie Rosamunde Pilcher auf afrikanisch. Das Abendessen wird unter einem knorrigen Baum bei Feuer und Kerzen serviert, unser Guide fungiert als der Barkeeper, die herzliche Camp-Managerin als helfende Hand und der Küchenchef als Zauberer. Filet, rosa auf den Punkt, mit Gemüse und frisch gestampftem Kartoffelpüree. Ich habe keine Ahnung, wie die Drei das an zwei offenen Feuerstellen hingekriegt haben.

Vom meinem Nachtlager aus blicke ich direkt auf die funkelnde Milchstraße. Welch ein Augenblick! Mitten im Busch schaut man ins Universum und wünscht sich bei jeder Sternschnuppe, dass dieser Moment unendlich anhält. Als ich am Morgen verstrubbelt aufwache ist der Zauber vorbei, aber die Erinnerung, die nehme ich mit.
Auf einen Gin Tonic am Boteti-Fluss...
Weiter geht die Entdeckertour in Richtung Kalahari mit einer Zwischenstation in der Lodge Meno a Kwena. Der Zahn des Krokodils, heißt das übersetzt – und der Name ist Programm: Die Lodge liegt wie ein Adlerhorst auf einer Anhöhe, direkt am Boteti Fluss, der das Farmland vom Nationalpark trennt und in dem sich die Reptilien tummeln. Manchmal sieht man dort auch schwimmende Kühe – ganz schön mutig!

Die Lodge gehört Hennie Rawlinson, der sitzt mir am Nachmittag auf der Veranda gegenüber und erzählt, dass er viele Jahre darauf gewartet hat, dieses Stück vom Himmel zu kaufen: Denn kurz vor Sonnenuntergang treffen sich an der Flussbiegung hunderte von Zebras und Elefanten, um zu trinken. Das Wiehern der Zebras klingt wie ein langgezogenes Lachen, die Elefanten bespritzen sich gegenseitig mit Wasser und alle scheinen Spaß zu haben. Hennie und ich prosten ihnen zu, mit Gin Tonic, der Medizin aller Afrikareisenden.
Die Kalahari...
Meine letzte Station ist die Kalahari, hier war ich vor sechs Jahren schon einmal. Ich erinnere mich, dass ich damals Erdmännchen beim Sonnenaufgang mit lebenden Skorpionen per Pipette gefüttert habe. Und meine Mutter, die ich mitgenommen hatte, um ihr „meine Sehnsucht Afrika“ zu zeigen, stand mittags mit Lockenwicklern vor dem Zelt und hielt Ausschau nach den wilden Tieren. Das Foto schauen wir seitdem immer mal wieder schmunzelnd an.
Hier im Süden Botswanas sind die Makgadikgadi Pans, eine der größten Salzwüsten der Welt. An deren Rand liegt eine riesige, private Konzession, mit drei außergewöhnlichen kleinen Lodges: das rustikale Camp Kalahari, es liegt versteckt im Busch, das romantische San Camp mit nur sechs weißen Zelten und Yogaplattform mit Blick auf die Salzpfanne und Jacks Camp, das Original. So müssen die Engländer früher gereist sein, mit Billardtisch, romantischen Himmelbetten und orientalischen Teppichen. Im Bad Samt rote Vorhänge, ein alter hölzerner Toilettenstuhl mit schwerem Deckel und Ziehspülung.

Jetzt stehe ich hier mit meinen verstaubten Trekkingschuhen auf dem Perserteppich und trinke Tee aus feinstem China Bone. Vor mir eine Graslandschaft durchzogen von kleinen Seen mit Flamingos. Schon verrückt. Dieses Jahr war der Frühlingsregen ungewöhnlich stark und kam später als geplant. Deswegen gibt es in der sonst so trockenen Landschaft rund um die Pfanne immer noch Wasser und dadurch viele Tiere. Elefantenherden, Zebras, Antilopen. Hier ist richtig was los, so kenne ich das Gebiet gar nicht.

„Give them what they never knew they wanted.“
Das ist der Slogan dieser Lodges und er stimmt, denn was man hier erlebt, das ist der Höhepunkt einer jeden Safari in Botswana. „Stephanie, get warm clothes and do not forget your Kikoy.“ Jetzt wird es ernst, der Kikoy ist ein rotes Tuch, das man sich wie ein Beduine um den Kopf wickelt, bevor man sein Quad besteigt und in die Salzpfanne brummt. Komplett vermummt, Brille an, Gang rein und das Abenteuer beginnt. Ich lege erst einmal Abstand zwischen mich und das Quad vor mir, der Staub ist unglaublich.

Nach einer Stunde Fahrt halten wir an. Mitten im Nichts! Hier sieht es aus wie auf dem Mond, am Horizont wölbt sich die Erde, der Boden ist grau, es wächst kein einziger Halm, Tiere gibt es auch nicht. Wahnsinn, ich lege mich mit dem Rücken auf die noch warme Salzkruste und schaue in den blitzblauen Himmel. Die Nachmittagssonne wird langsam schwächer und es erscheint erst ein, dann zwei, dann eine ganze Gruppe von Sternen. Innerhalb von 20 Minuten ist es, als hätte das Universum alle seine Türen geöffnet und lässt einen magischen Blick in die fernsten Galaxien zu. Das einzige Geräusch ist mein eigener Herzschlag, ein paar Tränchen rollen, es ist einfach ergreifend. Moments of lifetime. Es gibt ein Sprichwort aus Botswana: „Stille hat einen gewaltigen Lärm“, denke, das wurde hier geboren.
Die Sonne ist untergegangen, sofort wird es empfindlich kühl, die Truppe bläst zum Aufbruch. In der Ferne ein Licht, das ist das Ziel. Eine komplett ausgestattete Bar, Feuerstelle und ein gedeckter Tisch. Wir genießen ein Gourmetdinner im Mondschein und eine Schaufel glühende Kohle unterm Stuhl hält schön warm.
Letzter Tag: Frühaufsteher sehen mehr oder – besser auf afrikaans gesagt – ‚Meerkats‘. Die kommen nämlich kurz nach Sonnenaufgang aus ihrem Bau und genau vor dem Ausgang sitze ich mit der Kamera auf Stand-by. Hier gibt es seit Jahren eine Erdmännchenfamilie, die sich an Menschen gewöhnt hat. Angeblich hat es einmal einen Zwischenfall gegeben, bei dem der Truppe ein Baby bei der Flucht vor dem Raubvogel verloren ging. Die Biologin, die damals täglich die kleinen Nager beobachtete, brachte das Junge dann sicher zurück. Ab da wurden sie immer zutraulicher.
Und so ist es heute noch. Die ersten Zwei krabbeln aus dem Bau und stellen sich aufrecht zum Wärmen in die Sonne, nach und nach kommt die ganze Familie ans Tageslicht. Einer klettert wie selbstverständlich auf mein Knie, den Schwanz benutzt er wie einen Fotoständer damit er nicht umfällt. Wie süß! „Lass’ ja die Finger bei Dir“, murmele ich vor mich hin. Die Verlockung das kleine, wilde Pelztier zu streicheln, ist groß. Nach zehn Minuten ist dieser Teil der Show vorbei, die Tiere sind angewärmt und haben Hunger. Eifrig springen sie durch das Gras und graben Insekten aus.
Gerade kommt uns der Manager im Jeep entgegen: „Vorne liegen Löwen auf dem Weg“, sagt er. Jetzt wird es spannend. Fünfzig Meter weiter… da sind sie. Ein Pärchen im Liebesrausch, so erschöpft, dass die unseren Landrover völlig ignorieren und weiter pennen. Wenn Löwen lieben, dann machen sie es über mehrere Tage jede Viertelstunde, also warten wir ab. Und tatsächlich, 18 Minuten später tut sich etwas. Der Löwe gähnt und schüttelt sich, die Löwin springt auf, kurzes Schnuppern, dann der Akt. Er beißt sie in die Ohren, sie beißt ihn in den Hals, ein lautes Miau und ein kehliges Stöhnen, nach 30 Sekunden ist alles vorbei. Beide lassen sich ein paar Meter weiter wieder erschöpft ins Gras fallen.
Ein cooles Abschiedsgeschenk, denn in zwei Stunden geht es per Buschflieger zurück in die Zivilisation. Bevor ich in die Cessna steige, entdecke ich auf dem Flugfeld einen kleinen Busch mit wildem Basilikum. Ich zupfe ein paar Blätter ab und stecke sie in meine Kameratasche, neben die Speicherkarte mit 2561 Fotos.
Goodbye, Africa! Ich habe schon jetzt Sehnsucht nach Dir!














































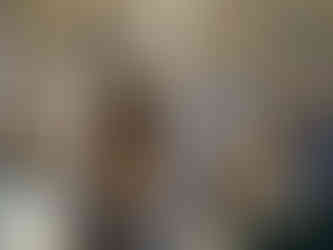










Kommentare